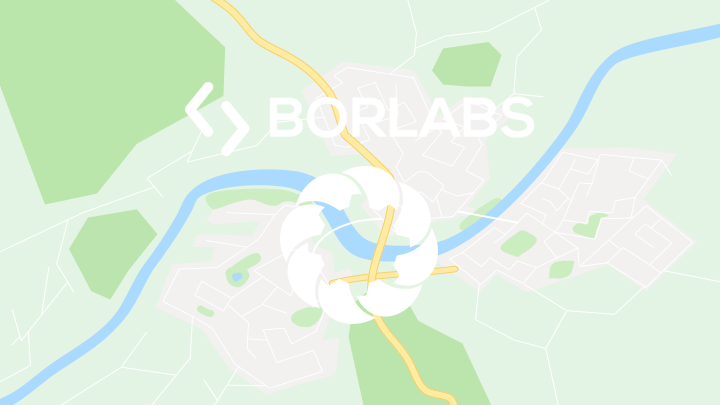
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Liebe Schülerinnen und Schüler,
„Heute erwartet euch eine spannende Radtour, die uns durch die Geschichte und Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers führt. Wir starten am Braunkohlekraftwerk Weisweiler, wo wir lernen, wie Strom aus Kohle gewonnen wird und welche Pläne es für die Zukunft gibt. Ihr werdet sehen, wie sich das Kraftwerk wandelt, um in Zukunft auf erneuerbare Energien zu setzen.
Danach radeln wir zum Hambacher Forst, einem Ort, der für seinen Widerstand gegen den Kohleabbau bekannt ist. Hier treffen wir Aktivisten und können mit ihnen über ihre Beweggründe sprechen. Ihr werdet verstehen, warum dieser Wald so wichtig für den Umweltschutz ist und welche Fragen wir den Aktivisten stellen können, um ihre Sichtweise zu verstehen.
Als Nächstes besuchen wir Bürgewald, das ehemalige Morschenich-Alt, das vor dem Abriss gerettet wurde und nun als „Dorf der Zukunft“ neu entsteht. Hier könnt ihr sehen, wie ein Ort sich wandeln kann und welche Chancen der Strukturwandel bietet. Wir werden auch nach Morschenich-Neu fahren, um zu sehen, wie sich ein komplettes Dorf anfühlt, wenn es verlegt wurde. Dabei werden wir uns auch die Frage stellen, inwiefern ein Dorf seine „Seele“ verlieren kann.
Wir werden auch darüber sprechen, wie der Hambacher Tagebau renaturiert wird und wie der riesige Hambachsee entstehen soll. Ihr werdet sehen, wie aus einer riesigen Grube ein neuer Lebensraum für Mensch und Natur geschaffen wird.
Die Rückreise führt uns am Dürener Badesee vorbei, der aus einer ehemaligen Tagebaugrube entstanden ist. Immer wieder taucht auf der weiteren Reise die imposante Silhouette des Kraftwerkes Weisweiler auf, ehe wir über eine wunderschöne Grünroute an der Inde in Eschweiler über Dürwiss wieder in Würselen ankommen. Damit ist die Königsetappe erfolgreich beendet.
Braunkohlekraftwerk Weisweiler
Das Braunkohlekraftwerk Weisweiler in Eschweiler-Weisweiler ist ein bedeutendes Kraftwerk der RWE Power AG. Es wurde 1955 in Betrieb genommen und dient der Grundlast. Über die Jahre hat es mehrere Ausbaustufen durchlaufen und erreichte eine maximale Nettoleistung von etwa 1.913 MW.
Geschichte und Bedeutung
Das Kraftwerk Weisweiler wurde ursprünglich von der Kraftwerk AG Köln errichtet und nahm 1955 den Betrieb auf. Es ist ein zentraler Bestandteil des Rheinischen Braunkohlereviers und versorgt neben der Stromerzeugung auch das Forschungszentrum Jülich sowie Teile von Aachen mit Fernwärme.
Pläne zum Ausstieg aus der Kohle
Im Rahmen des gesetzlichen, schrittweisen Kohleausstiegs in Deutschland wird das Kraftwerk Weisweiler seine Stromerzeugung auf Basis von Braunkohle bis 2029 einstellen. Dies ist Teil der deutschen Energiewende, die darauf abzielt, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und die CO2-Emissionen zu reduzieren.
Zukunft der Energieversorgung
RWE hat bereits Schritte unternommen, um das Kraftwerk Weisweiler zukunftssicher zu machen. Zwei 100- und 500 Meter tiefe Bohrungen wurden zur Erkundung geothermaler Energie niedergebracht. Diese Bohrungen sind Teil eines internationalen Forschungsprojekts zur Nutzung von Erdwärme. Fernwärme aus Thermalwasser könnte ein neuer Baustein der Energiewende im Rheinischen Revier sein.

Aussichtspunkt: Haus am See in Niederzier.
Da der Tagebau Hambach mit Rheinwasser geflutet werden soll, hat man diesen Ort: Haus am See genannt. Hier ein kleines Video vom Aussichtspunkt.
Der Hambacher Forst: Ein Wald im Widerstand
„Stellt euch vor, ein alter Wald soll für einen riesigen Kohletagebau abgeholzt werden. Das finden viele Menschen ungerecht und deshalb protestieren sie.
- Was ist der Hambacher Forst?
- Der Hambacher Forst ist ein Wald in der Nähe eines großen Braunkohletagebaus.
- Aktivisten leben dort in Baumhäusern, um gegen die Abholzung zu protestieren.
- Sie wollen, dass der Wald erhalten bleibt und dass wir aufhören, Kohle zu verbrennen.
- Warum protestieren sie?
- Sie sind besorgt um die Umwelt und das Klima.
- Sie finden, dass die Kohleindustrie zu viel Macht hat.
- Sie wollen, dass wir mehr erneuerbare Energien nutzen.
- Wie protestieren sie?
- Sie leben in Baumhäusern und errichten Barrikaden.
- Sie organisieren Demonstrationen und Aktionen.
- Manchmal kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.
- Kritische Stimmen:
- Es gibt Menschen, die sagen, dass die Aktivisten „lebensfremd“ sind.
- Auch wird gesagt, das die Aktiven ja auch von dem Wohlstand profitieren, den Sie kritisieren.
- Andere finden, dass ihre Aktionen zu radikal sind.
- Es wird auch gesagt, das der Kohleausstieg ja beschlossen ist, und die Aktivisten, nun in der Umsetzung mitgestalten sollten.
- Was bedeutet das für uns?
- Der Hambacher Forst ist ein Symbol für den Kampf um Umweltschutz.
- Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und uns eine eigene Meinung bilden.
- Es ist wichtig, das wir uns fragen, wie wir in Zukunft leben wollen.
Die Aktivisten im Hambacher Forst zeigen uns, dass jeder etwas für seine Überzeugungen tun kann. Aber es gibt auch unterschiedliche Meinungen darüber, wie man das am besten macht.

Alles, was ihr über den Hambacher Forst wissen solltet, findet ihr unter dem Foto- und Medienprojekt:
Über den Tellerrand
Liebe Schülerinnen und Schüler, mein Bewegrund für das Projekt: World Fair Play Camp war, euch schlau zu machen , damit ihr in eurer Zukunft lernt, Probleme zu bewältigen und nicht vor ihnen zu kapitulieren. Unsere Welt ist kompliziert geworden. Es gibt keine einfachen Lösungen. Die Leute, die diese versprechen, arbeiten mit Fake News und manipulieren die Menschen. Ihnen geht es nur um Geld und die eigene Macht. Damit ihr gewappnet seid für solche Gefahren, müsst ihr euch schlau machen und über den Tellerrand hinausschauen. Und wenn ihr es verstanden habt, müsst ihr auch anpacken. Ihr müsst vom Denken ins Handeln kommen. Am Beispiel „Hambacher Forst“ zeigt euch Dipl. Designerin
Uta Schmitz-Esser, wie man über den Tellerrand hinausschaut.
Eine Radtour zum Hambacher Forst bietet Kindern viele spannende Erkenntnisse und Lernerfahrungen:
Erkenntnisse:
Umweltbewusstsein: Kinder lernen über die Bedeutung von Wäldern und deren Schutz. Sie sehen, wie der Hambacher Forst von Aktivisten und Umweltschützern verteidigt wird.
Klimawandel und Energie: Sie erfahren mehr über die Auswirkungen des Braunkohletagebaus auf das Klima und die Notwendigkeit erneuerbarer Energien.
Naturschutz: Kinder sehen, wie der Wald sich selbst regeneriert und welche Arten von Pflanzen und Tieren dort leben.
Geschichte und Politik: Sie erfahren über die Geschichte des Hambacher Forsts und die politischen Auseinandersetzungen rund um den Tagebau.
Aktivismus und Gemeinschaft: Kinder sehen, wie Menschen zusammenarbeiten, um eine wichtige Sache zu verteidigen, und lernen über die Bedeutung von Aktivismus.
Fragen für Aktivisten:
Warum protestieren Sie gegen den Tagebau im Hambacher Forst?
Welche Auswirkungen hat der Tagebau auf die Umwelt und die Tierwelt?
Wie können wir als Kinder und Jugendliche helfen, den Wald zu schützen?
Welche Alternativen zur Braunkohlegewinnung gibt es?
Wie lange dauert es, bis sich der Wald nach einer Rodung wieder erholt?
- Weitere Fragen:
Fragen zur Motivation und den Zielen:
- Was hat Sie dazu motiviert, sich im Hambacher Forst zu engagieren?
- Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Protest?
- Gibt es ein bestimmtes Ereignis, das Ihren Einsatz für den Forst besonders beeinflusst hat?
Fragen zur Wirksamkeit des Protests:
- Wie bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Engagements bisher?
- Glauben Sie, dass Ihre Aktionen andere Menschen dazu ermutigen, sich ebenfalls für den Klimaschutz einzusetzen?
- Wie reagieren Sie auf Kritik, dass Ihre Methoden zu radikal oder unrealistisch seien?
Kritische Fragen zur Lebensweise und den Methoden:
- Warum entscheiden Sie sich dafür, weiterhin zu protestieren, obwohl der Kohleausstieg in Deutschland beschlossen wurde?
- Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Aktionen dem Umfeld und den Menschen in der Region keinen Schaden zufügen?
- Kritiker werfen Ihnen vor, dass manche Aktivisten den Protest eher als Lebensstil sehen. Was sagen Sie dazu?
- Wie reagieren Sie auf den Vorwurf, dass Ihre Aktionen illegales Verhalten beinhalten?
Fragen zur Perspektive auf die Gesellschaft:
- Sehen Sie eine Möglichkeit, mit Politikern oder Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Ihre Ziele zu erreichen?
- Was würden Sie Menschen raten, die Ihren Protest zwar unterstützen, aber nicht so aktiv wie Sie vorgehen möchten?
- Wie könnten Jugendliche selbst etwas für den Klimaschutz tun, ohne protestieren zu müssen?
Zukunftsfragen:
- Was passiert, wenn der Hambacher Forst endgültig geschützt ist? Werden Sie sich dann neuen Projekten widmen?
- Welche Veränderungen wünschen Sie sich in der Gesellschaft, damit solche Konflikte in Zukunft vermieden werden können?
Ein Besuch im Hambacher Forst kann Kinder inspirieren, sich für den Umweltschutz einzusetzen und ihnen zeigen, wie wichtig es ist, für die Natur einzustehen. Hast du schon einmal den Hambacher Forst besucht oder planst du einen Besuch?
.

Bürgewald: Vor dem Abriss gerettet – jetzt das Dorf der Zukunft
„Stellt euch vor, ein ganzes Dorf wird verlassen, weil es dem Kohleabbau weichen soll. Aber dann kommt alles anders und das Dorf darf bleiben und wird sogar zu einem Zukunftsdorf!
- Was ist passiert?
- Morschenich-Alt ist ein Dorf im Rheinischen Revier, das eigentlich dem Braunkohletagebau weichen sollte.
- Die Bewohner sind in ein neues Dorf umgezogen.
- Aber jetzt hat die Landesregierung entschieden, dass Morschenich-Alt wiederbelebt wird.
- Was wird gemacht?
- Aus dem alten Dorf soll ein modernes, nachhaltiges Dorf werden.
- Alte Gebäude werden restauriert und neue, umweltfreundliche Häuser werden gebaut.
- Auch die abgebrannte Kirche soll wieder aufgebaut werden.
- Der Ort soll an einen großen See grenzen, der durch den ehemaligen Tagebau entstehen soll.
- Warum das Ganze?
- Es ist das erste von sechs Dörfern, die wegen des Kohleausstiegs wiederbelebt werden.
- Es soll gezeigt werden, dass ein Wandel möglich ist und das man aus alten Tagebauen wieder neues Leben schaffen kann.
- Es soll ein Vorzeigebeispiel für andere Regionen werden, die ähnliche Veränderungen durchmachen.
- Wer hilft dabei?
- Die Landesregierung, die Gemeinde Merzenich und die Firma RWE arbeiten zusammen.
- Es gibt viel Geld vom Staat, um das Dorf wieder aufzubauen.
Morschenich-Alt ist also ein spannendes Projekt, bei dem ein altes Dorf zu einem modernen, zukunftsfähigen Ort wird. Das zeigt, dass auch in Zeiten des Wandels neue Chancen entstehen können.“
Bürgewald:
So wird dieses Geisterdorf wiederbelebt!
Goodbye Braunkohle! 90 Millionen für ein Dorf?!

Morschenich: Ein Dorf zieht um – und verliert seine Seele?
„Stellt euch vor, euer ganzes Dorf muss umziehen, weil unter euren Häusern Kohle liegt. Genau das ist in Morschenich passiert.
- Warum der Umzug?
- Unter Morschenich liegt Braunkohle. Die Firma RWE wollte diese Kohle abbauen.
- Deshalb mussten alle Bewohner ihre Häuser verlassen und in ein neues Dorf, „Morschenich-Neu“, umziehen.
- Das neue Dorf:
- Morschenich-Neu ist modern und neu gebaut. Es gibt neue Häuser, Straßen und Geschäfte.
- Eigentlich sollte man meinen, dass die Menschen dort glücklich sind.
- Aber… fehlt etwas?
- Viele Menschen sagen, dass das neue Dorf nicht das Gleiche ist wie das alte.
- Sie vermissen ihre alten Häuser, die vertrauten Straßen und die Orte, an denen sie aufgewachsen sind.
- Manche sagen, dass das neue Dorf keine „Seele“ hat. Damit meinen sie, dass es nicht die gleiche Atmosphäre und das gleiche Gemeinschaftsgefühl gibt wie im alten Dorf.
- Es ist wie mit einem alten Baum, den man verpflanzt. Er lebt weiter, aber er ist nicht mehr an dem Ort, wo seine Wurzeln hingehören.
- Was bedeutet das?
- Der Umzug von Morschenich zeigt, dass es nicht einfach ist, eine Gemeinschaft zu verpflanzen.
- Es ist wichtig, dass wir überlegen, was wir verlieren, wenn wir unsere Umwelt verändern.
- Es ist auch wichtig, dass wir versuchen, die „Seele“ von Orten zu bewahren, auch wenn sie sich verändern.
- Das neue Dorf ist zwar eine neue Heimat, aber die Erinnerungen und Gefühle an das alte Dorf bleiben bestehen.
Der Fall Morschenich zeigt uns, dass es beim Umweltschutz nicht nur um Zahlen und Fakten geht, sondern auch um die Gefühle und Erinnerungen der Menschen.“
Die Pläne für die Renaturierung des Hambacher Tagebaues sind umfassend und zielen darauf ab, eine attraktive und ökologisch wertvolle Landschaft zu schaffen. Hier sind einige der wichtigsten Punkte:
Hambach See: Der Tagebau wird in einen der größten Seen Deutschlands umgewandelt, der ab 2030 mit Rheinwasser gefüllt wird. Dieser See wird als Badegewässer, Segelrevier und Erholungsgebiet genutzt.
Wald-See-Landschaft: Zwischen Elsdorf und Kerpen entsteht eine attraktive Wald-See-Landschaft, die sowohl Freizeitmöglichkeiten als auch ökologische Vorteile bietet.
Erneuerbare Energien: Freiflächen, die nicht vom Wasser bedeckt sind, können für Solaranlagen genutzt werden, um grünen Strom zu erzeugen.
Waldgebiete: Die Waldgebiete südlich des Tagebaus, wie die Steinheide, der Hambacher Forst und der Merzenicher Erbwald, werden durch Waldstreifen, Hecken und Streuobstwiesen besser miteinander verbunden.
Landwirtschaftliche Rekultivierung: Mehr als 250 Hektar werden für die landwirtschaftliche Rekultivierung angelegt, um hochwertige Kiese und Sande zu nutzen.
Diese Pläne zeigen, dass der Hambacher Tagebau nicht nur eine ökologische Herausforderung darstellt, sondern auch eine Chance zur Schaffung einer lebenswerten und nachhaltigen Landschaft. Hast du Interesse an weiteren Details oder spezifischen Aspekten der Renaturierung?
Hier sind einige spezifische Details und Aspekte der Renaturierung des Hambacher Tagebaues:
Langfristige Ziele:
Wiederherstellung der Landschaft: Der Tagebau wird zu einem großen See umgewandelt, umgeben von Wäldern, Wiesen und Naherholungsgebieten. Die Renaturierung soll eine abwechslungsreiche und ökologische Landschaft schaffen.
Förderung der Biodiversität: Durch die Anpflanzung von verschiedenen Bäumen und Pflanzen soll die Biodiversität erhöht und Lebensräume für Tiere geschaffen werden.
Detaillierte Maßnahmen:
Auffüllung mit Rheinwasser: Ab 2030 wird der Hambach See mit Wasser aus dem Rhein gefüllt, was mehrere Jahre dauern wird. Der See wird dann als Bade- und Segelgewässer sowie als Erholungsgebiet genutzt.
Forstwirtschaftliche Maßnahmen: Die umliegenden Wälder wie die Steinheide, der Hambacher Forst und der Merzenicher Erbwald werden durch neue Waldstreifen, Hecken und Streuobstwiesen verbunden, um ein zusammenhängendes Ökosystem zu schaffen.
Landwirtschaftliche Flächen: Über 250 Hektar werden für die landwirtschaftliche Nutzung rekultiviert, wobei hochwertige Kiese und Sande verwendet werden.
Ökologische Korridore: Die Schaffung von ökologischen Korridoren ermöglicht es Tieren, sich frei zu bewegen und neue Lebensräume zu erschließen.
Planungs- und Beteiligungsprozesse:
Beteiligung der Öffentlichkeit: Die lokalen Gemeinden und Umweltschutzorganisationen sind in den Planungsprozess einbezogen, um sicherzustellen, dass die Renaturierung den Bedürfnissen und Erwartungen der Bevölkerung entspricht.
Wissenschaftliche Forschung: Forschungseinrichtungen überwachen und begleiten den Renaturierungsprozess, um sicherzustellen, dass ökologische und hydrologische Ziele erreicht werden.
Die Renaturierung des Hambacher Tagebaus ist ein langfristiges und komplexes Projekt, das darauf abzielt, eine nachhaltige und lebenswerte Landschaft zu schaffen.

Thementour: Braunkohle gestern – heute – morgen
Unsere heutige Tour starteten wir bei bereits warmen Temperaturen gegen 8:26 Uhr. Unser erster Stopp führte uns nach ca. 19 Kilometern zum Braunkohlekraftwerk nach Weisweiler. Dort haben wir uns das Kraftwerk von außen angeschaut und eine kleine Pause gemacht.
Über die wegen des Braunkohlekraftwegs stillgelegte alte A4 fuhren wir in Richtung Manheim, wo wir auch unser ortsansässigen Führer Hubert, einen ehemaligen Förster, trafen.
Ein Teil der Gruppe fuhr mit Hubert nach Manheim, einen bereits umgesiedelten Ort, und in das Sündenwäldchen, das seinen Namen laut Hubert daher bekam, dass sich die jungen Pärchen in der NS-Zeit in diesem Wäldchen vergnügten. Heute ist das Sündenwäldchen von Aktivisten besetzt, da es für die Renaturierung des Tagesbaus abgeholzt werden soll. Hubert hielt an verschiedenen Punkten des Tagebaus mit uns an und erklärte, dass der Tagebau 400m tief ist und 9 x 9 Kilometer groß sei.
Zeitversetzt haben beide Gruppen am Nachmittag die Bewohner im Hambacher Wald aufgesucht. In gemütlicher Atmosphäre durften wir viele Fragen zu verschiedensten Themen stellen. Fragen wurden unter anderem gestellt zur Lebenssituation der Bewohner, zu den persönlichen, aber auch gemeinschaftlichen Zielen und Zukunftsperspektiven und zu politischen Einstellungen. Gerade der letzte Punkt war für uns etwas befremdlich, da die Bewohner sich als Anarchisten bezeichneten und ihre Abneigung der Demokratie gegenüber deutlich kundtaten. Dies machte uns noch einmal deutlich wie wichtig Bildung und Aufklärung ist!
Parallel dazu besuchte die jeweils andere Gruppe den Waldlehrpfad. Dort lernten wir, wie sehr das Ökosystem des Waldes unter der Verkleinerung durch den Tagebau leidet, da ehemals im Schutz des Waldes stehende Bäume nun an der Außengrenze des Waldes stehen und diesen Anforderungen nicht gewachsen sind.
Im Anschluss daran fuhren wir in den Ort Bürgewald, der vor drei Jahren noch Alt-Morschenich heiß. Dort klärte uns ein Verantwortlicher über die Geschichte des Dorfes, vor allem über die Umsiedelung der Bewohner nach (Neu-)Morschenich und die aktuellen Herausforderungen auf.
Anschließend fuhren wir begleitet von heißen Temperaturen noch circa 40 Kilometer zurück in unser Camp.
Wir sind uns sicher, dass dieser Tag und die Begegnungen, die wir heute machen durften, uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Wir haben gelernt, Dinge von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und Zusammenhänge (kritisch) zu hinterfragen.
Eva, Birgit, Anna Lena

